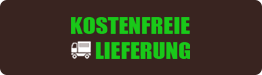Die gesetzlichen Regelungen rund um Gasheizungen in Deutschland haben sich in den letzten Jahren maßgeblich verändert – hauptsächlich wegen der Umsetzung des Ziels der Klimaneutralität bis 2045.
Ab dem Jahr 2045 soll ein vollständiges Verbot für Heizsysteme gelten, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden – darunter auch Gas- und Ölheizungen.
Wärmepumpen spielen eine Schlüsselrolle bei diesem Wandel. Das GEG (Gebäudeenergiegesetz) fördert explizit den flächendeckenden Einsatz von Wärmepumpen in Deutschland als eine der zentralen Säulen klimafreundlicher Heizlösungen.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssten jedoch bis 2045 etwa 10–15 Millionen (einige Schätzungen sprechen sogar von 17 Millionen) Wärmepumpen installiert werden.
Das Ziel ist ehrgeizig – doch wie realistisch ist die Umsetzung?
Woher sollen die 15 Millionen Wärmepumpen herkommen?
Wie viel Strom wird für ihre Betreibung benötigt und wie wird dieser Strom erzeugt?
Wie hoch werden die Stromrechnungen der Haushalte ausfallen, wenn mit Strom geheizt wird?
Gibt es ausreichende Kapazitäten für den Einbau von 15 Millionen Wärmepumpen?
Gibt es ausreichende Kapazitäten für den vollständigen Umbau von 15 Millionen Heizsystemen?
Wie sollen die Menschen das finanzieren, wenn die Fördermittel gekürzt werden?
Wie viele Gebäude müssen saniert werden, um für Wärmepumpensysteme geeignet zu sein?
Wie viele Gebäude müssen zusätzlich gedämmt werden, um mit einem Niedertemperatursystem, der Notwendig ist, beheizt werden zu können?
Wie viele funktionierende Gasheizungen landen auf dem Müll als Sondermüll?
Wie viele funktionierende Heizkörper müssen entsorgt werden?
In welchen Abständen müssen Wärmepumpen ersetzt werden und erzeugten regelmäßig Sondermüll? (Die Ausfallquote einer durchschnittlichen Wärmepumpe liegt bei etwa 7%, die Lebensdauer bei nur 7–10 Jahren – ein Austausch ist also regelmäßig erforderlich.)
Erleben wir hier das nächste „Elektroauto-Hype-Phänomen“?
Was denken Sie darüber?